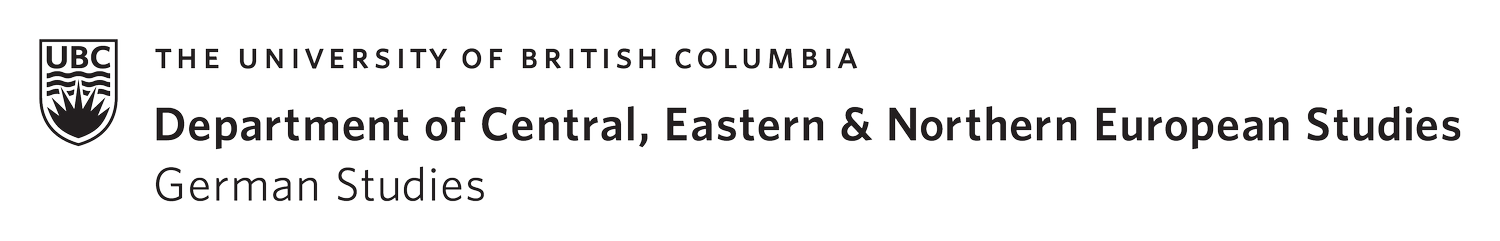Nächster Halt, Niemandsland
Nächster Halt, Niemandsland: Fremde und Einheimische Wahrnehmungen der Deutschen Teilung in Literatur und Film
Grace Philippon
Abstract
Im späten 20. Jahrhundert erschienen in Deutschland viele Filme und literarische Werke, die sich mit der Teilung Deutschlands auseinandersetzen. Die Großstadt Berlin wird als Schauplatz der Teilung dargestellt, ob aus der Perspektive der Einwohner oder aus der Perspektive der Menschen, die sich in der Stadt fremd fühlen. Als Motiv, um die Teilung Berlins sowohl aus der Perspektive der Außenseiter wie auch der Einheimischen darzustellen, werden in Film und Literatur vor der Wende oft öffentliche Transportmittel benutzt, wie zum Beispiel in Wim Wenders Film Der Himmel über Berlin (1987), Peter Schneiders Erzählung Der Mauerspringer (1982) und Uwe Johnsons Kurzgeschichte „Nachtrag zur S-Bahn“ (1970). Obwohl die Transportmittel für die Außenseiter als Repräsentationen der Teilung Berlins existieren, lässt sich auch zeigen, dass diese Transportmittel Niemandsländer schaffen, die zugleich Schauplätze einer einheimischen Erinnerungspolitik sind. Mithilfe der Werke von Wenders, Schneider und Johnson zeige ich in diesem Beitrag auf, inwiefern es das Motiv der Transportmittel uns erlaubt, die unterschiedlichen Wahrnehmungen der Außenseiter und der Einwohner Berlins hinsichtlich der deutschen Teilung zu verstehen.
Viele der bekanntesten deutschen Werke der Nachkriegszeit befassen sich mit der Teilung Deutschlands und dessen Auswirkungen auf die davon betroffenen Menschen, insbesondere im Kontext der Berliner Großstadt. Im Folgenden werde ich drei Werke besprechen, die dieses Thema behandeln. In Peter Schneiders Erzählung Der Mauerspringer (1982) sucht der Ich-Erzähler einen Mann, der sein ,,Ich“ verliert und zum Grenzgänger zwischen Ost und West wird. Der Erzähler sammelt die Geschichten von Menschen, die die Grenze überquert haben, und setzt sich währenddessen mit seiner eigenen Identität auseinander. Der Film Himmel über Berlin (1987) von Wim Wenders handelt von zwei Engeln, die versuchen, Menschen im geteilten Berlin zu trösten, woraufhin einer der Engel sich in eine Frau verliebt und eventuell zu einem Menschen wird. In Uwe Johnsons Kurzgeschichte ,,Nachtrag zur S-Bahn“ (1970) wird die Teilung von Berlin durch die Metapher der S-Bahn dargestellt. In jedem dieser drei Werke wird das Motiv der Transportmittel verwendet, um die Teilung des deutschen Staates sowie die Lage von Berlin in der Nachkriegszeit aus den kontrastierenden Perspektiven der Außenseiter und der Einwohner darzustellen. Obwohl die Transportmittel für die Außenseiter als Repräsentationen der Teilung Berlins existieren, lässt sich auch zeigen, dass diese Verkehrsmittel Niemandsländer schaffen, die zugleich Schauplätze einer einheimischen Erinnerungspolitik sind.
In Himmel über Berlin spielen Transportmittel von Anfang an eine wichtige Rolle für die Darstellung der Stadt; obwohl die Teilung von Berlin während Peter Falks Einreise im Flugzeug nicht explizit anerkannt wird, wird es dennoch klar, dass man ihr selbst in der Luft nicht entkommen kann. Es wird eine Luftaufnahme von Berlin gezeigt, die höchstwahrscheinlich den Blick aus Falks Fenster darstellen soll. Obwohl die Mauer in dieser Einstellung nicht zu sehen ist, ist die Teilung immerhin präsent. Die Luftaufnahme wurde von der linken Seite des Flugzeuges gefilmt, und die Gebäude auf der rechten Seite der Aufnahme scheinen größer zu sein als die auf der linken Seite (siehe Fig. 1). Dies deutet darauf hin, dass das Flugzeug aus dem Westen in den Osten über West-Berlin fliegt, mit dem wahrscheinlichen Ziel vom Flughafen Tempelhof. West-Berlin ist aus der Vogelperspektive genau zu erkennen; ein Kameraschwenk versichert aber, dass die Stadt von Wolken verdeckt wird, als das Flugzeug sich Ost-Berlin nähert. Obwohl keine visuellen Zeichen der Teilung in der Szene vorhanden sind, scheint es, dass nur die westliche Hälfte Berlins dargestellt wird. Eine weitere Luftaufnahme bestätigt diese Hypothese; es ist ein Funkturm zu erkennen, und die Zuschauer hören extradiegetische Radiosendungen auf Englisch und auf Deutsch, die eindeutig in West-Berlin gesendet werden. Es folgt, dass Berlin aus der Perspektive des einreisenden Außenseiters geteilt dargestellt wird, was durch die Flugroute des Flugzeugs unterstützt und ermöglicht wird.
Figur 1. Der Blick über Berlin, aus dem Fenster des Flugzeuges gesehen. Der Himmel über Berlin, Regie: Wim Wenders, 1987.
In der Sequenz, in der der Engel Damiel (Bruno Ganz) den Menschen in der U-Bahn tröstet, passen die Auswirkungen der Teilung auf das West-Berliner Volk zu der eingeschränkten Bewegungsfreiheit der U-Bahn. Damiel nimmt als Außenseiter den Kummer der Menschen in der U-Bahn wahr, was der Einschränkung ihrer Fortbewegung durch die Berliner Mauer entspricht (siehe Fig. 2). Es wurde eine tragbare Kamera benutzt, um diese Sequenz aufzunehmen, was den Einstellungen eine intime Qualität verleiht. Die Kamera bewegt sich horizontal von Mensch zu Mensch, und ihre Gedanken, wie Damiel sie hört, werden kommentiert. Viele von den Berlinern fühlen sich bedrückt und hoffnungslos, was auch an ihren Gesichtsausdrücken zu sehen ist. Obwohl die Menschen sich noch mit der U-Bahn durch die Stadt bewegen können, sind sie, wie in ihrem Leben auch, von der Grenze zwischen Osten und Westen limitiert. Aus seiner Perspektive als Außenseiter sieht Damiel die negativen Auswirkungen der Teilung auf die Einwohner West-Berlins, verdeutlicht durch das Symbol der U-Bahn.
Figur 2. Der Engel Damiel tröstet einen Mann in der U-Bahn. Der Himmel über Berlin, Regie: Wim Wenders, 1987.
Während sie einerseits von dem Regisseur benutzt werden, um die Teilung des deutschen Staates zu zeigen, stellen die Transportmittel im Film andererseits auch ein positiv konnotiertes Niemandsland an der Mauer dar. In der ersten Einstellung der Sequenz, in dem Damiel den alten Mann zum ehemaligen Potsdamer Platz begleitet, stehen der Engel und der Mann zusammen im Mittelpunkt des Bildes (siehe Fig. 3). Von den linken und rechten Seiten zeichnen jeweils die Berliner Mauer und das Gleis einer Magnetbahn, die konstruiert wurde, um das von der Mauer unterbrochene U-Bahn-System zu unterstützen, diagonale Linien nach unten (,,M-Bahn Berlin“). Wenders erwähnte in einem Interview, dass dieser Ort, ,,eine Stadtwüste [war], eine Steppe, ein Niemandsland“ (Wenders, zit. in Zander). Laut Michael Braun ist dieses Niemandsland ,,eine Leerstelle im geografischen Gedächtnis der Stadt“ (Braun 228). Obwohl der Potsdamer Platz nicht mehr existiert, ist dieser Ort immerhin keine Leerstelle im Berliner Gedächtnis. Der alte Mann erinnert sich dort an ,,Straßenbahnen … Omnibusse mit Pferden … zwei Autos …“ und noch vieles mehr (Wenders). Seine Erinnerungen an den Potsdamer Platz drehen sich interessanterweise um verschiedene Transportmittel und beziehen sich auf die Zeit, als Berlin noch vereint war. In dieser Sequenz ist das von Transportmittel geschaffene Niemandsland ein Schauplatz der Erinnerung an eine vereinte Vergangenheit.
Figur 3. Damiel und der alte Mann zwischen der Mauer und dem Magnetbahngleis. Der Himmel über Berlin, Regie: Wim Wenders, 1987.
Wie Himmel über Berlin auch, beginnt Der Mauerspringer mit einer Szene im Flugzeug, indem ein Reisender die geteilte Stadt betrachtet. Giannina Widmer nach ,,fällt [es] auf, dass der Ich-Erzähler in dieser Passage noch nicht greifbar wird, sondern … als wahrnehmende Figur vorschiebt, der sich Berlin im Flugzeug nähert“ (Widmer 44). Obwohl es sich eigentlich um den Erzähler handelt, wird Berlin in dieser Passage bewusst aus der Perspektive eines Außenseiters dargestellt. Der Erzähler behauptet zuerst, die zwei Hälften der Stadt bieten aus der Vogel- perspektive gesehen ,,einen durchaus einheitlichen Anblick,“ erwähnt die Mauer jedoch in seiner Beschreibung von Berlin als ,,teilende[s] Bauwerk“ und ,,phantastischen Zickzackkurs“ (Schneider 5–6). Trotz der Betonung der Ähnlichkeit der beiden Stadthälften spielt die Mauer eine wichtige Rolle für die Wahrnehmung des Reisenden (Anderson 366). Dem Erzähler nach ,,stellt er [nachträglich] fest, daß sich einzig der Schatten des Flugzeugs frei zwischen beiden Stadtteilen bewegen konnte“ (Schneider 6). Obwohl das Flugzeug die Fortbewegung des Reisenden ermöglicht, wird diese endgültig, wie seine Wahrnehmung der Stadt auch, durch die Teilung Berlins eingeschränkt. Das Symbol des Flugzeugs wird in Der Mauerspringer verwendet, um die Teilung Berlins aus der Perspektive der Außenseiter zu unterstreichen.
Das Gespräch zwischen dem fremden Mann und dem Erzähler am Flughafen Schönefeld stellt die Teilung im Kontext der Fortbewegung dar. Der fremde Mann möchte mit dem Erzähler zusammen in einem Taxi nach Berlin fahren, versteht aber nicht, dass die Fortbewegung der beiden Männer durch ihre jeweiligen Transportmöglichkeiten und Stadthälften eingeschränkt ist (Schneider 11). Auf den ersten Blick scheint es so, als ob der fremde Mann die Stadt als vereint wahrnimmt, aber danach wird klar, dass er nur Ost-Berlin meint, wenn er über ,,Berlin“ spricht. Er kann nicht fassen, dass Berlin außerhalb des östlichen Raums existieren könnte, und dass eine gemeinsame Taxifahrt unmöglich wäre (Schneider 11–12). Es wird auf der Karte im Flughafen tatsächlich nur Ost-Berlin gezeigt, und im Westen sind ,,keine Straßen verzeichnet, keine Plätze, keine U-Bahn-Stationen“ (Schneider 11). Die Transportmittel definieren die Stadt—ohne sie ist es so, als ob West-Berlin nicht existiert. Obwohl der Fremde die Teilung nicht auf die gewöhnliche Weise wahrnimmt, ist sie dennoch die Basis für seine Vorstellung von Berlin, was sich an seinem Vorschlag einer gemeinsamen Taxifahrt erkennen lässt.
Im Kontrast zu den Wahrnehmungen der Fremden von der geteilten Stadt wird in Der Mauerspringer der Bus am Flughafen als Niemandsland und Schauplatz der Berliner Erinnerung dargestellt. Dem Erzähler nach sprechen die Deutschen im Bus zusammen Sächsisch und Berlinerisch, eine sprachliche Verbindung, die eine gewisse Einheit zwischen ihnen schafft (Schneider 9). Dies dauert jedoch ,,nur die kurze Strecke vom Flugzeug zur Ankunftshalle. Noch bevor die Deutschen vor den beiden Türen, die den Eingang in zwei verschiedene Staaten bezeichnen, Aufstellung nehmen, entsteht ein Zwischenraum“ (Schneider 9). In diesem metaphorischen Niemandsland existieren die Ost- und West-Berliner zusammen als Deutsche. Nur nachdem sie aus dem Bus steigen, kommen die Unterschiede zwischen Ost und West zum Vorschein (Schneider 10). Für die Einwohner Berlins ist das von dem Bus geschaffene Niemandsland ein Ort, an dem sie sich durch eine gemeinsame Sprache an die Vergangenheit Berlins erinnern können.
In der Kurzgeschichte ,,Nachtrag zur S-Bahn“ ist der Vergleich zwischen Transport- mitteln und der Teilung aus der Perspektive der Außenseiter unübersehbar. Johnson nach war es vor der Teilung ,,die S-Bahn, die den Zuwanderer bekannt machte mit der Stadt. Sie zog ihn … mit ausstrahlenden Radialen und einem riesigen Ring, so brachte sie ihm einen räumlichen Begriff dieser Gegend bei“ (Johnson 42). Johnson verwendet das Mittel der Metapher, um die Teilung Berlins durch das S-Bahn-System darzustellen. Wie Müller-Tamm und Regeler erwähnen, ,,[stehen] S-Bahn und Stadt metonymisch füreinander ein“ (Müller-Tamm und Regeler 40). Johnson schreibt: ,,Früher … hielt die S-Bahn auch noch die zerstrittenen Städte Berlin zusammen … nun ist der Ring zerbrochen“ (Johnson 42). Weil die S-Bahn für die Stadt Berlin einsteht, dient die Metapher des zerbrochenen Rings dazu, die geteilte Lage der Stadt darzustellen. Es folgt, dass die S-Bahn dem Zuwanderer nach der Teilung zwei unterschiedliche räumliche Begriffe der Gegend beibringt. Aus der Perspektive der einreisenden Außenseiter ist Berlin genauso geteilt wie das S-Bahn-System auch.
Die Fremden in ,,Nachtrag zur S-Bahn“ sind so fest von der Teilung der Stadt überzeugt, dass sie fast nicht mehr an die ehemalige Einheit des Transportsystems glauben. Der Erzähler beschreibt, wie die Gleise der S-Bahn mitten in Berlin enden und meint, dass die Fremden den Berlinern nicht glauben, ,,daß auf solchen sinnlosen Erdwülsten eine Schnellbahn hinüberging“ (Johnson 42). Wer das vereinte Berlin nicht kannte, kann es sich auch nur schwer vorstellen. Johnson schreibt, dass ,,echte, wirkliche, tatsächliche Bahndämme“ in der Stadtmitte weggeräumt wurden (Johnson 42). Er benutzt drei gleichbedeutende Wörter, eins nach dem anderen, um zu unterstreichen, dass es sich bei der Teilung nicht nur um ein abstraktes Konzept handelt, sondern um etwas Wirkliches. Johnsons visuelle Beschreibung des abrupten Endes der Gleise verstärkt seine Darstellung der geteilten Stadt dadurch, dass das Konzept der Teilung in etwas Fassbares umgesetzt wird. Die Fremden können sich die Stadt und das Transportsystem nicht vereint vorstellen, ohne zu verstehen, wie es vorher aufgebaut war.
Obwohl es den Fremden schwerfällt, sich ein vereintes Berlin vorzustellen, schafft die S-Bahn dennoch eine Art Niemandsland, das für die Berliner zu einem Ort der Erinnerung wird. Es wird in dem Text ,,ein extraterritorialer Bahnsteig mitten in Ostberlin“ erwähnt, und der Erzähler behauptet, dass ,,die S-Bahn … das Ihrige tun [muss], um uns an die Lage der Stadt zu erinnern“ (Johnson 42). Die West-Berliner können an diesem Bahnsteig von Richtung Nord-Süd in den Westen umsteigen, aber es ist ihnen verboten, in Ost-Berlin aussteigen; das heißt, für sie existiert der Bahnsteig ausschließlich als eine Art Zwischenort oder Niemandsland (Johnson 42). Die Ost-Berliner nutzen einen anderen Bahnsteig an derselben Haltestelle, was die Bezeichnung des Ortes als Niemandsland weiterhin unterstützt. Müller-Tamm und Regeler nach ,,[erscheinen] vor allem die Bahnhöfe … nicht als gesichtslose Transiträume, sondern im Gegenteil als Orte des Erinnerns“ (Müller-Tamm und Regeler 40). An dem extraterritorialen Bahnsteig erinnern sich die Berliner an das vereinte Berlin—dem Erzähler nach ,,[hält] die Stadtbahn … uns die Vergangenheit der Stadt im Gedächtnis“ (Johnson 43). Das Niemandsland am Bahnsteig, das von der S-Bahn geschaffen wird, ist für die Berliner ein Schauplatz der gemeinsamen Erinnerung.
In allen drei Werken stellt das Motiv der Transportmittel die Lage der Berliner Großstadt in der Nachkriegszeit dar. Der Himmel über Berlin und Der Mauerspringer beginnen beide mit einer Einreise in einem Flugzeug, indem ein Außenseiter die Stadt von der Luft aus betrachtet. Eine genaue Analyse dieser Szenen enttarnt einige wichtige Zeichen der Teilung, die hinter einer Fassade der Einheit verborgen sind. Der Zuwanderer in ,,Nachtrag zur S-Bahn“ nimmt Berlin ähnlich wahr wie die Reisenden in den anderen beiden Werken; obwohl er den Mangel an Zusammengehörigkeit nicht unbedingt selbst bemerkt, erlaubt ihm der zerbrochene Ring der S-Bahn immerhin nicht, sich völlig mit der Gegend bekannt zu machen. Er unterscheidet sich von den anderen jedoch, indem er sich die Stadt nicht vereint vorstellen kann. Die drei Außenseiter fokussieren sich auf die Teilung der Berliner Großstadt, was durch das Motiv der Transportmittel dargestellt und unterstrichen wird. Die Einwohner Berlins dagegen erleben die Niemandsländer, die zugleich von den Transportmitteln geschaffen werden, als Schauplätze der gemeinsamen Erinnerung. Obwohl das Berlin der deutschen Nachkriegszeit, dargestellt in den Werken von Schneider, Wenders und Johnson, eindeutig und einzigartig geteilt ist, existiert in seinen Zwischenräumen noch die Möglichkeit der Erinnerung an eine vereinte Vergangenheit.
Works Cited
Anderson, Susan C. “Walls and Other Obstacles: Peter Schneider’s Critique of Unity in Der Mauerspringer.” The German Quarterly, vol. 66, no. 3, 1993, pp. 362–71.
Braun, Michael. “‘Botschaftsverkehr’ von Unten: Engel in Wim Wenders’ Der Himmel Über Berlin.” In Im Zeichen des Unverfügbaren: Literarische Selbst- und Fremdbilder im 20. und 21. Jahrhundert, edited by Yvonne Dudzik et al. transcript Verlag, 2023, pp. 223–36.
Johnson, Uwe. “Nachtrag zur S-Bahn.” Berliner Sachen, Suhrkamp Verlag, 1975, pp. 42–43.
“M-Bahn Berlin.” Berliner Verkehrsseiten, www.berliner-verkehrsseiten.de/m-bahn/.
Müller-Tamm, Jutta, und Lukas Nils Regeler. “Fahrt mit der S-Bahn: Bewegung und Raum im geteilten Berlin.” Zeitschrift für Interkulturelle Germanistik, vol. 13, no. 2, 2022, pp. 37–54.
Schneider, Peter. Der Mauerspringer. Hermann Luchterhand Verlag GmbH & Co KG, 1982.
Wenders, Wim, Regisseur. Der Himmel über Berlin. Basis-Film-Verleih GmbH, 1987.
Widmer, Giannina Leonie. “‘Über die Mauer’ und das Loch mitten in Berlin: Berlin-Literatur vor und nach der Wende – literaturgeographisch betrachtet.” Ein Literarischer Atlas Europas, Universität Basel, 2010, https://www. literaturatlas.eu/files/2012/03/1_Master arbeit_Giannina-Widmer.pdf. Accessed Dec. 7 2023.
Zander, Peter. “Wim Wenders: Muffensausen beim ‘Himmel Über Berlin.’” Die Welt, May 2, 2007. www.welt.de/kultur/kino/article846526/Muffensausen-beim-Himmel-ueber- Berlin.html.
Grace Philippon is a junior in the School of Foreign Service at Georgetown University. She is majoring in Regional and Comparative Studies with a focus on Western Europe and the Middle East. Grace presented this paper at the 2024 Undergraduate Research Conference in German Studies, hosted by Moravian University and Lafayette College, where she was awarded the Max Kade Prize for the Best Research Project and Presentation.
Picture: “U-Bahnhof ADN-ZB Kaufhold 15.8.80 Berlin: Der Puls der Großstadt schlägt in der Schönhauser Allee Ecke Dimitroffstraße besonders kräftig” by Reinhard Kaufhold. Aug. 15, 1980. From Wikimedia. Source: German Federal Archives (Bundesarchiv). This image is licensed under Creative Commons 3.0.