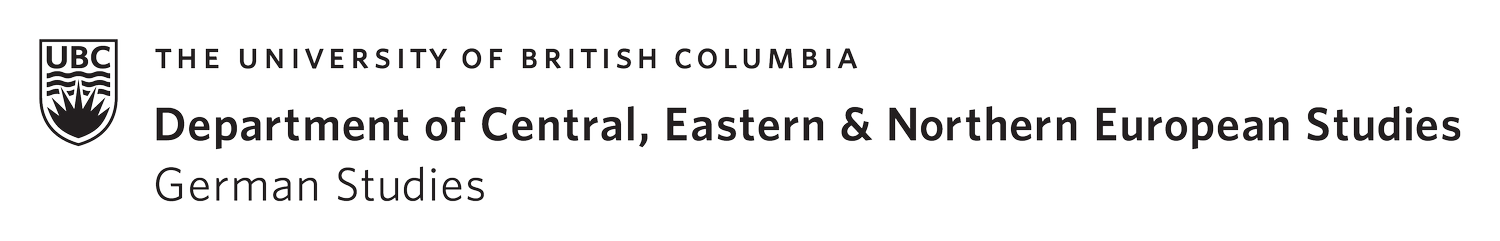Biedermann und die Brandstifter und Der Besuch der alten Dame
Biedermann und die Brandstifter und Der Besuch der alten Dame: Ein Vergleich
Joshua Hutson
Abstract
Im folgenden Aufsatz vergleiche ich Biedermann und die Brandstifter und Der Besuch der alten Dame bezüglich Struktur und Charakteren, um einen Rahmen für eine Kritik von Kapitalismus und Kommunismus anzubieten. Ich schlage vor, dass die Hauptfiguren beider Stücke tragische Helden sind, deren tragische Fehler zeigen, dass die grundlegenden Eigenschaften für Kapitalisten und Kommunisten im Rahmen von ihrem jeweiligen System zum Untergang führen. Ich erforsche Claire und die Brandstifter als Vertretung von Kapitalismus und Kommunismus und betone die Interaktionen zwischen ihnen und den Hauptfiguren als Interaktionen zwischen einem Jedermann und dem System, in dem er lebt. Endlich hebe ich die heutzutage maßgebliche Botschaft der Stücke hervor.
Weil sie beide in den 50er-Jahren in der Schweiz geboren wurden und während des kalten Krieges schrieben, sind Friedrich Dürrenmatt und Max Frisch vergleichsreif. Zum Punkt gibt es viel Literatur, die sich mit dem Leben und Arbeit der zwei Schriftsteller befasst und auch viel Literatur, die die Themen und Leben der zwei direkt vergleicht. Dennoch sind Biedermann und die Brandstifter und Der Besuch der alten Dame, die weltberühmtesten Stücke von ihrem jeweiligen Schriftsteller, fast nie tief miteinander untersucht, obwohl sie individuell tief erforscht werden. Im Kontext der Zeit könnten diese Theaterstücke als Gegenstücke verstanden sein. Ich glaube und werde in diesem Aufsatz meine Argumente geben, dass durch eine Analyse und Vergleich der Hauptfiguren, Antagonisten, Struktur und Themen beider Stücke maßgeblichen Kommentar zur Politik unserer Zeit in beiden Stücken gefunden werden kann.
Wenn man ein Verständnis von Frisch und Dürrenmatt als Schriftsteller und infolgedessen ihren Stücken bekommen will, muss man den historischen Hintergrund kennen, um darin ihre Einflüsse zu finden. Die Schweizer Schriftsteller haben aus der Sicht eines Schweizer geschrieben. Laut Bänziger beeinflusste Brecht die zwei sehr stark, indem er „[die Illusion, dass] der Bühnenvorgangs ohne Publikum stattfinde“ zerbrach (19). Wie Brecht setzen sie sich mit einer Folge der Zerschlagung dieser Illusion auseinander, dem Verfremdungseffekt. Beide Schriftsteller wollten, dass ihre Stücke das Publikum dazu zwingt, über ihr Verständnis von sich selbst und der Welt nachzudenken. Gleichzeitig behauptet Bänziger „Die Überwindung der Enge und der Isolation musste die Dichtung leisten; Frischs und Dürrenmatts Werke sind in der Tat Ausbrüche [oder ein] Versuch, mit dem anderen ins Gespräch zu kommen“ (14). Er geht weiter und sagt, dass die historische Isolation und Neutralität der Schweiz Sachlichkeit an Brecht und infolgedessen an Frisch und Dürrenmatt stark geprägt hat (21). Bänziger malt ein Bild von Frisch und Dürrenmatt als Schriftsteller, die ein Gespräch mit anderen durch ihre Arbeit führen wollten, und die versuchten, direkt mit dem Publikum zu sprechen. Sie könnten auch einander beeinflusst haben, aber bezüglich der Briefsammlung zwischen Frisch und Dürrenmatt sagt Herausgeber Rüedi, „Dieser Briefwechsel ist kein Monument wie andere, an denen die Beteiligten mit Blick auf Nachlässen und Nachruhm gemeißelt haben“ (9). Wenn sie einander beeinflusst haben, gibt es fast keine Hinweise in Briefen aneinander.
Mit demjenigen Bild glaube ich an den Wert einer Interpretation beider Stücke im politischen Kontext der Zeit. Dennoch ist es nicht die vorherrschende Meinung über die Schriftsteller. Jenny argumentiert, “A critical assessment of Dürrenmatt’s plays cannot be an exploratory assessment of the ‘problems’ they contain” und, dass seine Stücke “are not concerned with the welfare state, the capitalist system or atomic war, but with responsibility, treachery, guilt, atonement, loyalty, freedom and justice” (21–22). Er hebt hervor, dass die universalen Themen und nicht der Kontext der Zeit als das Entscheidende gehalten werden soll. Ebenso fokussiert Brian Murdoch in seinem Aufsatz auch nicht auf die Probleme der Zeit in den Stücken Frischs und Dürrenmatts, sondern auf das Thema von Kollektivschuld, obwohl das Konzept von Kollektivschuld sich abhängig von einer Gesellschaft und ihren Werte ändert (112). Obwohl universale Themen bedeutsam sind, ist es auch wichtig zu bemerken, dass Dürrenmatt eine eindeutig kapitalistische Welt und eine eindeutig kapitalistische Antagonistin erschaffen musste, um seine universalen Themen in Der Besuch der alten Dame auszudrücken. Frisch, der sich mit ähnlichen Themen befasst, erschafft die Welt in Biedermann und die Brandstifter, sodass Geld fast keine Rolle spielt. Beide interessieren sich für Themen wie Gerechtigkeit, Schuld und Verantwortlichkeit aber erforschen sie in zwei unterschiedlichen Kontexten. Das heißt, in beiden Fällen ist der Kontext noch ein wichtiges Teil des Verständnisses der Themen und sollte deshalb erforscht werden.
Bevor ich weitergehe, ist es nötig Kapitalismus und Kommunismus zu definieren. Ich stelle fest, dass beide als Machtgefüge zu verstehen sind, Kapitalismus basierend auf Geld und Kommunismus basierend auf soziales Kapital. In Kapitalismus benutzen Leute Geld, um ihren Wille herbeizuführen, entweder durch das Kaufen von Waren oder Arbeitskräften. Ausweislich eines ähnlichen Prinzips arbeiten Leute für den Willen eines Anderen für versprochenes Geld. Mit echtem Kommunismus beeinflusst man einander nicht mit Geld, sondern mit dem Glauben daran, dass das Gute der Gemeinde verwirklicht werden soll. Die Gemeinde bedient das Wohlbefinden ihrer Mitglieder und das heißt, wenn man die Gemeinde von seinen Ideen überzeugen kann, kann man seinen Willen dadurch verwirklichen. Claire und die Brandstifter verkörpern diese Kräfte, und deswegen vertreten sie das System ihres Stückes. Claire vertritt Kapitalismus als Machtgefüge und die Brandstifter vertreten Kommunismus als Machtgefüge.
Der Besuch der alten Dame (1956) von Friedrich Dürrenmatt erzählt die Geschichte der Stadt Güllen, als eine ehemalige Bürgerin und heutige Milliardärin Claire Zachanassian zu Besuch kommt. Die Stadt kennt die Absicht ihres Besuchs nicht aber hofft, dass sie Güllen Geld geben wird. Ill, der einmal in Beziehung mit Claire stand, versucht ihre ehemalige Beziehung zu benutzen, um Geld für die Stadt zu bekommen. Endlich bietet Claire den Güllenern eine Milliarde unter einer Bedingung an: die Stadt muss Ill töten. Am Anfang behaupten die Güllener, dass sie ihre Moral nicht verkaufen werden, aber im Verlauf der Geschichte fangen sie an, materialische Sachen zu kaufen. Ill fürchtet sich davor, dass sie ihn wirklich töten werden, und am Ende ermordet die Stadt Ill und bekommt das Geld von Claire.
Biedermann und die Brandstifter (1963) von Max Frisch folgt Herrn Biedermann und seiner Frau, als sie mysteriöse Besucher bei sich aufnehmen. Am Anfang liest Herr Biedermann die Zeitung, in der neue Brandstiftungen beschrieben werden. Der selbstsichere Biedermann stellt fest, dass solche Dinge ihm nicht passieren könnten, aber dann klopft jemand an die Tür. Schmitz, ein Obdachlose, bittet Herr Biedermann um eine Unterkunft. Biedermann erlaubt Schmitz in seinem Obdach zu bleiben. Babette, die Frau Biedermanns, vertraut Schmitz nicht und fordert Biedermann dazu, Schmitz rauszuwerfen. Biedermann versucht es, aber er findet einen anderen Mann auf dem Dachboden, Eisenring. Der verwirrte Biedermann erlaubt beiden zu bleiben, obwohl er eine Zündkapsel und Benzin sieht. Er glaubt, dass er damit seinen guten Willen zeigt. Am Ende gibt Biedermann mit gutem Willen den Brandstiftern das Streichholz, damit sie sein Haus und ihn niederbrennen können.
Dürrenmatt betrachtete Claire als seinen missverstandensten Charakter, wenn er einmal sagte, „Claire Zachanassian stellt weder die Gerechtigkeit dar noch den Marshallplan oder gar die Apokalypse…sie sei nur das, was sie ist, die reichste Frau der Welt…wie eine Heldin der griechischen Tragödie zu handeln, absolut, grausam“ (Bänziger 181). Dürrenmatt wollte nicht, dass Claire ein Symbol werde, aber er hat sie doch noch mit ihrem Geld und Macht definiert. Ihre Hauptmerkmale im Augen Dürrenmatts sind Reichtum und wie sie ihren Reichtum benutzt, um ihre Umgebung zu ändern. Während des Stückes verdirbt sie die Güllener indirekt mit ihrem Angebot. Dank ihres Besuchs kaufen die Güllener bessere Produkte wie Radios, Tabak und Cognac, während Claire durch den ganzen zweiten Akt auf dem Balkon sitzt, ein Ort, der höher als die Handlung steht, eine symbolische Betonung ihrer Macht über Güllen (Dürrenmatt 60). Sie fürchtet sich nicht vor Ill oder anderen Menschen. Claire glaubt nicht an die Fähigkeit Ills, sie zu erschießen, also reagiert sie mit Zuversicht. Sie deutet Ill an, wenn du mich schießen willst, mach es, weil sie glaubt, dass er es nicht machen kann (Dürrenmatt 79). Dürrenmatt benutzt die Güllener durchwegs als Chor, wie in einer altgriechischen Tragödie (Grüber 151), welche andeutet, dass Claire reich und kräftig genug ist, den historisch objektiven altgriechischen Chor zu verderben. Die vorgegebenen Beispiele fördern die Idee Elliots, dass „Claire Zachanassian den Kapitalismus mit all seinen Reizen und Gefahren [verkörpert]” (47).
Die Brandstifter in Biedermann und die Brandstifter sind ähnlich kräftig inszeniert. Wie Claire auf dem Balkon arbeiten die Brandstifter auf dem Dachboden, der höher als das Übrige des Hauses ist. Die Brandstifter haben keine Furcht vor Biedermann. Eisenring sieht keinen Grund, Biedermann anzulügen und erklärt ihm:
EISENRING. […] die sicherste Tarnung ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Komischerweise. Die glaubt niemand. (Frisch 43)
Die Brandstifter sagen Biedermann die Wahrheit und erwarten, dass er doch nichts damit machen wird. Am Ende des Stückes fragt Eisenring Biedermann nach einem Streichholz, das er Eisenring freiwillig gibt, ein Beweis der Macht, die die Brandstifter über Biedermann ausüben. Denn welche Macht haben die Brandstifter eigentlich? Sie nutzen die Begierde Biedermanns, ein guter Mensch zu sein, also begründen sie ihre Macht tief in dem „guten Willen“ anderer Leute. Die Brandstifter wissen, dass Biedermann eine hohe Meinung von sich selbst hat, und benutzen es, um ihn zu betrügen. Sie deuten an, dass er kein guter Mensch wäre, wenn er nicht einem armlosen Obdachlosen helfen würde:
SCHMITZ. […] Sie glauben noch an das Gute in den Menschen und in sich selbst. Oder hab ich nicht recht? (Frisch 14)
Biedermann will, dass andere Leute ihn als eine gute Person sehen und deswegen läßt er Schmitz rein. Bei der Konfrontation mit dem Chor am Ende des dritten Akts sagt Biedermann als Verteidigung:
BIEDERMANN. […] Ein bisschen Vertrauen muss man schon haben, ein bisschen guten Willen. (Frisch 38)
Weil der Chor wie ein altgriechischer Chor handelt, deutet Frisch an, dass die Brandstifter so viel Macht über Biedermann haben, dass er nicht mal einer objektiven Stimme zuhören kann.
Beide Antagonisten sind kräftiger als die Hauptfigur und arbeiten unabhängig von der Hauptfigur. Das heißt, Claire lässt die Güllener den Mord Ills ohne ihre direkte Handlung begehen und die Brandstifter würden noch das Haus niederbrennen, wenn Biedermann nicht mit ihnen zusammengewirkt hätte. Die Hauptfiguren müssen die Förderungen der Antagonisten entweder freiwillig oder implizit akzeptieren. Deswegen funktionieren die Brandstifter und Claire nicht als Charaktere, sondern als systematische Naturgewalten, mit denen die Hauptfiguren kämpfen müssen, und deshalb schlage ich vor, dass Claire Kapitalismus vertritt und die Brandstifter Kommunismus vertreten.
Die Hauptfiguren sind auf der anderen Seite schwach gegen die Kraft der Systeme, gegen die sie kämpfen. Ill hat kein Geld aber stattdessen sozialen Einfluss in einem Kontext, in dem Geld Kraft bringt und Biedermann hat Geld aber keinen sozialen Einfluss in einem Kontext, in dem sozialer Einfluss Kraft bringt. Ich werde drei Behauptungen über Biedermann und Ill machen. Erstens sind sie beide tragische Helden mit einem tragischen Fehler. Zweitens vertreten beide ein Jedermann. Drittens sind beide gute Mitglieder ihres jeweiligen Systems. Das heißt, im Fall Ills ist er ein guter Kapitalist und im Fall Biedermanns ist er ein guter Kommunist. Durch das erste und dritte Argument werde ich zeigen, dass die tragischen Fehler beider Hauptfiguren gleichzeitig das Merkmal sind, das sie gute Mitglieder ihrer Systeme macht.
Die Literatur ist nicht einheitlich bezüglich Ills Status als tragischer Held. Laut Crockett, “Is he, then, a tragic hero? Despite some critics who would see him in this light, the majority of scholars have recognized that Dürrenmatt does not grant him that privilege…his sacrifice plays out against a background of baseness and moral depravity that are not ameliorated, only increased, by his sacrifice” (88). Crocketts Argument basiert auf die mangelnde Moralität Ills und die Stadt Güllens, aber ich glaube, dass das nicht genug ist, Ills Status als tragischer Held auszuschließen. In seiner Beschreibung einer perfekten Tragödie erklärt Aristoteles „it neither satisfies the moral sense nor calls forth pity or fear”, und beschreibt den perfekten tragischen Held: „[He is] a man who is not eminently good and just, yet whose misfortune is brought about not by vice or depravity, but by some error or frailty” (14). Eine Tragödie braucht keinen moralischen Helden, nur einen, der nicht völlig gut und nicht völlig böse ist. Ill passt zu diesem Begriff.
Es ist kein wegweisendes Argument, dass Ill Sünde und ein echtes Verbrechen begangen hat. Das Stück erzählt uns durch den Butler, wie Ill Claire geschwängert hat und wie er zwei Jungen mit einem Liter Schnaps zum Eidbruch bestochen hat, sodass er die Konsequenzen seiner Handlung nicht tragen müsse (Dürrenmatt 46–48). Dennoch obwohl es ein völlig verkommender Moment Ills Leben ist, ist es nur ein Moment. Am Anfang des Theaterstücks ist Ill als der nächste Bürgermeister Güllens bezeichnet. Die Güllener erkennen Ill als ein Guter und einer, der die Bezeichnung Bürgermeister verdient. Er verbringt vierzig Jahre als Stütze seines Kleindorfs. Keiner im ersten Akt drückt eine schlechte Meinung von ihm aus. Es ist erst in dem zweiten Akt, nachdem Claire Ills Verbrechen veröffentlicht, dass der Bürgermeister Ill sagt:
DER BÜRGERMEISTER. […] Sie besitzen nicht das moralische Recht … und auch als Bürgermeister kommen Sie nicht in Frage. (Dürrenmatt 70)
Seine Wortwahl deutet an, dass die Stadt vorher glaubte, dass er das moralische Recht besitze, Bürgermeister zu werden. Dann ist er nicht völlig böse. Ill muss zur Rechenschaft gezogen werden, aber wie Sotiraki betont, „er leidet mehr, als er verdient, und er kann dadurch beim Zuschauer Mitleid erzeugen“ (24). Ill ist ein tragischer Held.
Mein zweites Argument behauptet, dass Ill ein Jedermann ist. Ill unterscheidet sich fast nicht von anderen Güllener außer seiner Affäre mit Claire. Er ist Güllener bis zum Angebot Claires, nach dem die Güllener sich von Ill distanzieren. Obwohl Dürrenmatt will, dass das Publikum sich mit den Güllener identifiziert, könnte das Publikum sich auch mit Ill identifizieren, und weil er ein von zwei genannten Charakteren ist, wirkt er für das Publikum persönlicher.
Das dritte Argument, dass Ill ein guter Kapitalist ist, braucht eine Definierung eines guten Kapitalisten. Für den Zweck dieses Aufsatzes lege ich dar, ein guter Kapitalist sei der angedeutete theoretische Teilnehmer des Systems. Laut Jahan und Mahmud, gibt es sechs Säulen im Kapitalismus: Privatbesitz, Eigeninteresse, Konkurrenz, Handlungsfreiheit, einen Marktmechanismus und beschränkte Regierungsrolle (44). Aus dieser Liste folgt, dass ein guter Kapitalist hauptsächlich eigeninteressiert ist. Es ist klar von seiner Handlung in Bezug auf Claire, als sie Jugendliche waren, dass Ill eigeninteressiert ist. Statt seine moralische Verantwortung zu akzeptieren, entscheidet Ill, Eidbruch zu begehen. Claire deutet auch an, dass Ill Hintergedanken über seine Hochzeit hat:
ILL. Dir zuliebe habe ich Mathilde Blumhard geheiratet.
CLAIRE. Sie hatte Geld. (Dürrenmatt 37)
In dem zweiten Akt handelt Ill aus verzweifeltem Eigeninteresse. Er fordert den Polizisten und den Bürgermeister an, Claire zu verhaften (Dürrenmatt 61; 70). Nach mangelndem Erfolg damit versucht er Claire zu erschießen, obwohl er zu schwach ist, den Abzug zu betätigen (77). Endlich versucht er von Güllen wegzulaufen, bevor die Güllener ihn am Bahnhof gegenübertreten (85). Es ist nur nach dieser Konfrontation, dass er seine Fehler erkennt und er seine Schuld akzeptiert.
Dennoch bringt Ills Eigeninteresse seinen Untergang und das heißt, im Kontext einer Tragödie, ist Eigeninteresse sein tragischer Fehler. Am Ende des dritten Aktes gibt Ill zu:
ILL. Ich habe Klara zu dem gemacht, was sie ist, und mich zu dem, was ich bin […] Alles ist meine Tat. (Dürrenmatt 102–103)
Also die Merkmale, die Ill zu einem guten Kapitalisten machen, sind genau der Grund seines Untergangs.
Auf der anderen Seite steht Biedermann. Im Gegensatz zu Ill begeht er kein Verbrechen, aber er stirbt trotzdem am Ende der Geschichte. Dennoch benimmt er sich nicht perfekt, insbesonders bezüglich Herrn Knechtling. Er weigert sich mit Knechtling zu sprechen, obwohl Knechtling getreulich für ihn arbeitet, entlässt ihn, eine Tat, die wahrscheinlich zu dem Tod Knechtlings führt, und entscheidet, die Beerdigung Knechtling nicht zu besuchen (Frisch 16; 21; 50). Er ist nicht völlig böse aber auch nicht völlig gut.
Um zu behaupten, dass Biedermann ein guter Kommunist ist, brauchen wir eine Definierung eines guten Kommunisten. Wie vorhin, lege ich dar, ein guter Kommunist sei der angedeutete theoretische Teilnehmer dahin und dafür, um das besser zu verstehen, müssen wir das Kommunistische Manifest befragen. Hier finden wir ein Glaubensbekenntnis mit Fragen bezüglich des Verständnisses und der Handlung eines Kommunisten. Obwohl die Mehrheit dieser Fragen sich auf den Glauben konzentrieren, gibt es eine hilfreiche Frage, deren Antwort uns Einblick in der angedeuteten Handlung eines Kommunisten gewährt, nachdem eine kommunistische Gesellschaft gegründet wird. Laut des Manifests:
Question 2: What is the aim of the Communists?
Answer: To organize society in such a way that every member of it can develop and use all his capabilities and powers in complete freedom and without thereby infringing the basic conditions of this society (Marx and Engels 134)
Dann ist das wesentliche Merkmal eines Kommunisten seine Hingabe zum Wohlbefinden seiner Gesellschaft. Wenn wir die Handlung zwischen Biedermann und den Brandstiftern untersuchen, gibt es ein Argument für solche Hingabe aufseiten Biedermanns. Er lässt Schmitz und Eisenring auf seinem Dachboden übernachten, er lügt im Auftrag der Brandstifter die Polizisten an, als sie ihm nach dem Benzin fragen, und er gibt Eisenring das Streichholz als Zeichnen seines Vertrauens (Frisch, 17;32;66). Dennoch stellt dieses Argument nicht die wichtige Handlung des Stückes ab. Erstens obwohl dieses Argument zu der Handlung Biedermanns mit den Brandstiftern passen könnte, wird es lächerlich in der Handlung Biedermanns mit Knechtling. Es gibt keine Beispiele im Stück für Biedermanns Hingabe zum Wohlbefindens Knechtling:
BABETTE: Warum hast du Knechtling entlassen?
BIEDERMANN: Weil ich ihn nicht mehr brauche. (Frisch 21)
Biedermann sieht seine Beziehung mit Knechtling als transaktionale, eine vernehmlich kapitalistische Aussicht für einen Kommunisten. Wahrlich ist es unmöglich in gutem Glauben zu argumentieren, dass Biedermann ein Vorbild eines guten Kommunisten vertritt. Dennoch sagt Frisch etwas anderes mit Biedermann, etwas, was mit Biedermanns Status als Jedermann eng verknüpft ist.
Jurgensen betont ein entscheidendes Paradox, wenn er erklärt, „Es wird uns deutlich, dass Frisch mit dem Namen Biedermann seinen ‚Jedermann‘ gesellschaftlich festgelegt hat: er ist aber kein ‚Jedermann‘, sondern ein reicher Bürger…“ (161). Später argumentiert Jurgensen, dass Biedermann als Vertreter der moralischen Schwäche des Bürgertums bezeichnet werden sollte, aber solch eine Interpretation ignoriert Biedermanns Namen (163). Frisch wollte, dass das Publikum sich mit Biedermann identifiziert, und deswegen wird er Biedermann genannt. Obwohl das Publikum sich nicht mit dem Sozialstatus von Biedermann identifizieren kann, sollen sie doch etwas mit Biedermann teilen. Ich schlage vor, dass das Publikum die moralische Schwäche, die Jurgensen betont, mit Biedermann teilt. Im Kontext dieses Argument ist diese Schwäche das Eigeninteresse. Es ist nicht genug, den Fehler Biedermanns als nur einen Fehler des Bürgertums beizumessen. Stattdessen gilt der tragische Fehler Biedermanns, der gleiche Fehler Ills, für jeden Mensch. Damit sagt Frisch nicht, dass Biedermann ein guter Kommunist sei, sondern, dass er kein guter Kommunist sein kann.
Soweit habe ich argumentiert, dass Kapitalismus seine Teilnehmer verletzt und Kommunismus wegen der menschlichen Natur praktisch unmöglich ist. Wenn man diese Argumente akzeptiert, muss man sich mit seiner Antwort abmühen. Es ist verlockend, eine passive Vorgehensweise zu nehmen und direkte Interaktionen mit dem System zu vermeiden. Dennoch verstehen beide Frisch und Dürrenmatt solche Neigung und haben Passivität in ihren Stücken in Angriff genommen.
In Der Besuch der alten Dame wird Ill immer passiver wegen seiner Akzeptanz seines Schicksals. Ill rechtfertigt seinen zwangsläufigen Tod, weil er argumentiert, dass die Rache Claires wegen ihm passiert:
ILL. Ich sah ein, dass ich kein Recht mehr habe … Was soll ich tun, Lehrer von Güllen? Den Unschuldigen spielen? Alles ist meine Tat. (Dürrenmatt 102–103)
Der Ursprung seiner Passivität stammt aus seiner Akzeptanz von Schuld. Er überzeugt sich selbst, dass seine Schuld nur durch seinen Tod bezahlt werden kann. Er trägt die Schuld für die Rache Claires aber Dürrenmatt läßt Güllen nicht so einfach weitermachen. Sie müssen die Schuld für den Mord zusammentragen, obwohl sie am Ende oberflächlich erfolgreich scheinen. Dadurch benutzt Ill seine Passivität, um gegen die Güllener zu kämpfen. Die Güllener müssen mit ihren Seelen bezahlen und Ill zwingt sie, es zu erkennen, als er passiv wird. Seine letzten Wörter stellen seine Verurteilung des Systems dar:
PFARRER: hilflos Ich werde für Sie beten.
ILL: Beten Sie für Güllen. (Dürrenmatt 128)
Passivität und Schuld spielen eine andere Rolle in Biedermann und die Brandstifter. Biedermanns Verweigern, die Brandstifter aus seinem Haus zu werfen, zeigt seine mangelnde Fähigkeit, seine Schuld zu tragen. Laut Murdoch kann Biedermann nicht erkennen, dass die Brandstifter ihn verbrennen werden, weil seine Selbstgefälligkeit und Bequemheit ihn zum Glaube führen, dass ihm nichts Schlechtes passieren könnte (116). Deswegen ist er passiv. Wenn er nicht so handelt, dann könnten er, seine Frau und seine Nachbarn noch leben. Schütz und Vokt argumentieren, dass Biedermann wegen seiner Passivität tatsächlich der Brandstifter seines Hauses ist (141). Er ist auch passiv mit Knechtling und erkennt nicht, dass er wahrscheinlich für den Tod Knechtlings verantwortlich ist. Frisch deutet an, dass Knechtling sich selbst ohne Hilfe von Biedermann umbringt. Wobei Ill wegen seiner Schuld passiv ist, ist Biedermann trotzt seiner Schuld passiv. Das Ende ist das gleiche für beide, aber immerhin erkennt Ill, dass er verantwortlich ist. Für Leser beider Stücke ist es erkennbar, dass Passivität nicht immer möglich oder wünschenswert ist aber es kann als Widerstand benutzt werden. Leider ändert in beiden Fällen absichtliche und unbeabsichtigte Passivität nichts für Ill oder Biedermann und sie sterben noch trotzdem.
Frisch und Dürrenmatt stellen die Frage, wie man mit dem System, in dem man lebt, handeln soll, aber sie geben keine klare Antwort. Dadurch erreichen sie den höchsten Verfremdungseffekt: sich von seiner Gesellschaft zu entfremden. Ich mache keinen weiteren Versuch, das Paradox von Verständnis und Verhältnis zwischen der Einzelperson und seiner Gesellschaft zu lösen, weil solche Versuche zu der Absicht Frisch und Dürrenmatt unehrlich wären. Stattdessen wollten die zwei Schriftsteller, dass jeder kritisch über seine Rolle in der Gesellschaft denkt und das Paradox selbst löst. Es ist leider nicht zu vermeiden.
Works Cited
Aristotle. Poetics. Translated by S.H. Butcher, Project Gutenberg, January 22, 2013, https://www.gutenberg.org/files/1974/1974-h/1974-h.htm.
Bänziger, Hans. Frisch und Dürrenmatt. Bern, Francke Verlag, 1987.
Crockett, Roger Alan. Understanding Friedrich Dürrenmatt. Univ. of South Carolina Press, 1998.
Dürrenmatt, Friedrich. Der Besuch der alten Dame. Zurich, Diogenes Verlag, 1998.
Elliott, Paul. Modern Languages Study Guides: Der Besuch der alten Dame. London, Hodder Education, 2017.
Frisch, Max. Biedermann und die Brandstifter. Frankfurt, Suhrkamp, 1996.
Frisch, Max, and Friedrich Dürrenmatt. Briefwechsel, edited by Peter Rüedi, Zurich, Diogenes Verlag, 1998.
Grueber, William. Comic Theaters: Studies in Performance and Audience Response. Univ. of Georgia Press, 1986.
Jahan, Sarwat, and Ahmed Saber Mahmud. “Back to Basics: What Is Capitalism?” Finance & Development, vol. 52, no. 2, 2015, pp. 44–45.
Jenny, Urs. Dürrenmatt. London, Eyre Methuen, 1978.
Jurgensen, Manfred, editor. Frisch; Kritik, Thesen, Analysen. Bern, Francke Verlag, 1977.
Marx, Karl, and Friedrich Engels. “Manifesto of the Communist Party.” Translated by Samuel Moore and Friedrich Engels. Karl Marx and Frederick Engels. Selected Works, Vol. One, Moscow, Progress Publishers, 1969, pp. 98–137.
Murdoch, Brian. The Fortunes of Everyman in Twentieth-century German Drama. Camden House, 2022.
Schütz, Erhard, and Jochen Vogt. “Parabeltheater: Frisch Und Dürrenmatt.” Einführung in Die Deutsche Literatur Des 20. Jahrhunderts, vol. 3, Verlag für Sozialwissenschaften Wiesbaden, 1980, pp. 140–52.
Sotiraki, Flora. Friedrich Dürrenmatt als Kritiker seiner Zeit. Frankfurt, Peter Lang Verlag, 1983.
Joshua Hutson received his undergraduate degree in applied mathematics, German studies, and IT from Furman University and recently graduated from the University of Tennessee Knoxville with his master’s degree in business analytics.
Picture: “"Biedermann und die Brandstifter" by Max Frisch played by Baerum Teaterselskap at Sandvika Teater in 2013.” Jan 29, 2021. From Wikimedia. This image is licensed under Creative Commons 4.0.